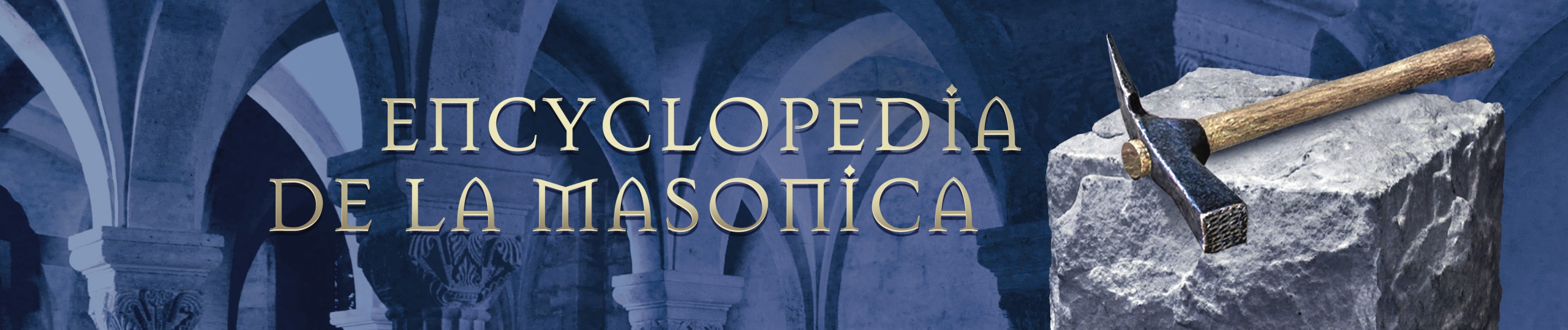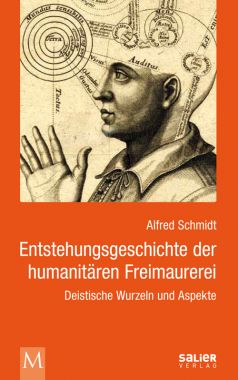Philosophiegeschichtliche Aspekte der Idee einer Natur- oder Vernunftreligion
Philosophiegeschichtliche Aspekte der Idee einer Natur- oder Vernunftreligion
Auch hier ist die Sache älter als ihr Begriff. Was um 1560 in Frankreich als deistische Lehre aufkommt, beginnt schon bei den Stoikern, die Bloch wegen ihres menschheitlichen Universalismus die „antiken Freimaurer“42 nennt. Poseidonios (ca. 135-51 v.Chr.) unterscheidet erstmals angeborene von erworbenen Quellen der Religion: „Die erste Quelle der Religion ist eine allen Menschen, Hellenen und Barbaren, angeborene Vorstellung von der Gottheit, die aus der Wirklichkeit selbst und aus der Wahrheit entspringt, und die nicht willkürlich oder zufällig zustande kommt, sondern die äußerst lebhaft und ewig von aller Zeit her ist, die bei allen Völkern entstand, und die man fast als ein jedermann zukommendes Gemeingut unserer vernunftbegabten Gattung ansehen kann.“43
Poseidonios spricht hier bereits den Kerngedanken der aufklärerischen Religionswissenschaft aus, dass es sich bei der Religion um eine allen Menschen gemeinsame Vorstellung vom Göttlichen handelt, die in der Gleichartigkeit ihrer vernünftigen Natur wurzelt. Diese wiederum gründet in der göttlichen Allnatur, weshalb Poseidonios jener Vorstellung objektive Wirklichkeit und Wahrheit zuerkennt. Cicero (106-43 v. Chr.) wird in den Tusculanae disputationes (I,13,30) das stoische, bis zum englischen Deismus fortwirkende Motiv wiederaufnehmen, dass die Notwendigkeit von Religion durch die Übereinstimmung aller Völker belegt werde. Cicero zögert nicht, den consensus omnium gentium mit einem Naturgesetz gleichzustellen. Ähnlich argumentiert der spätrömische Stoiker Seneca (ca. 4 v. Chr.-65 n. Chr.), bei dem es heißt: „Wir legen in der Regel auf eine allen Menschen gemeinsame Voraussetzung großes Gewicht und sehen es als einen Beweis der Wahrheit an, wenn in irgendwelcher Sache allgemeine Übereinstimmung herrscht.
So glauben wir an das Dasein von Göttern unter anderem auch deshalb, weil allen eine Ahnung von den Göttern innewohnt und es nirgends ein Volk gibt, das so aller Gesetzlichkeit und Sittlichkeit entrückt wäre, daß es nicht an das Dasein irgendwelcher Götter glaube.“44 Andererseits ist auch Seneca davon überzeugt, dass dieser consensus gentium insofern zugleich objektiv begründet ist, als der „in ungestörter Schnelligkeit sich vollziehende Sternenlauf, der so große Massen von Erde und Meer, so viele hellstrahlende und nach fester Ordnung leuchtende Lichter mit sich führt, sich nur unter dem Machtgebot eines ewigen Gesetzes vollziehen kann“45.
Es erübrigt sich für Seneca, der hier wie ein neuzeitlicher Aufklärer spricht, „darzutun, daß dieser gewaltige Weltenbau nicht bestehen könne ohne irgend einen Hüter und daß dieses Sternenheer mit seinen mannigfachen Bahnen nicht Wirkung eines zufälligen Anstoßes sei“46. Einen anderen, aber ebenfalls die Aufklärung vorwegnehmenden Akzent gewinnt die Frage nach dem Wesen der Religion bei dem Scholastiker Roger Bacon (ca. 1214-1294), der die auf Erfahrung, Experiment und Mathematik sich gründende Wissenschaft scharf von der Theologie trennt. Unter arabischem Einfluss gelangt Bacon zu der Auffassung, den „verschiedenen symbolischen Ausgestaltungen“ der Religion liege die Moral als ein „einheitlich Gemeintes“ zugrunde: die in viele „Parabeln und Geschichten“ eingekleidete „Anweisung des rechten Lebens“47.
Hier schon bildet die Moral den Kern der Religion. Die Quellenlage gestattet es nicht zu entscheiden, ob der neuzeitliche, sich ausdrücklich religionsphilosophisch verstehende Deismus in antitrinitarischen Strömungen der Reformationszeit, in der Reaktion auf die Glaubenskriege des sechzehnten und siebzehnten Jahrhunderts oder in der humanistischen Rezeption der Stoa und des Epikureismus wurzelt; die Forschung nimmt an, dass alle genannten Faktoren bei der Genese des Deismus mitgewirkt haben.48 Vorbereitet wird er durch Autoren der italienischen Renaissance wie Laurentius Valla (1409-1457) und Ludovicus Vives (1492- 1540), die Dilthey als frühe Verfechter eines theologischen Rationalismus einschätzt. Darunter versteht er „die souveräne Reflexion des Verstandes über den Glaubensinhalt, durch welche dieser in ein Verhältnis von Gott, Christus, Mensch, von freiem Willen und Einwirkungen Gottes, als von lauter einander fremden Selbständigkeiten zerlegt wird“49. Es erweist sich als problematisch, die Bestandteile des Glaubens wie bisher dogmatisch zu verknüpfen. Immer häufiger treten unitarische Tendenzen auf.
So bei dem Platoniker Marsilio Ficino (1433-1499), der eine religio communis entwirft, an deren Wahrheit die positiven Religionen, die er als Emanationen der einen göttlichen Vernunft betrachtet, in verschiedenem Grade beteiligt seien. Pico della Mirandola (1463-1494) strebt nach einer über die Vielfalt der Religionen hinausführenden Synthese aus neuplatonischen, kabbalistischen und christlichen Elementen. Der Humanist Mutianus Rufus (1471-1526) spricht die religionsphilosophische Tendenz der Zeit aus in dem Satz: „Viele Gottheiten, richtiger viele Namen, aber nur ein Gott.“50
Auch Erasmus von Rotterdam (1466-1536), eine europäische Figur, ist darauf bedacht, sich über den endlosen Streit der Religionsparteien zu erheben. Praktizierte Moral ist ihm wichtiger als theologischer Hader. Er ist davon überzeugt, dass sich der Katalog des zu Glaubenden erheblich vereinfachen lässt. Erasmus‘ Schrift De libero arbitrio (1524), die sich mit Luthers Theologie beschäftigt, reduziert die universale, das „reine Evangelium“ enthaltende „Offenbarung“ auf vier Gebote, die zugleich umschreiben, was er unter Frömmigkeit versteht:
- Gott als Herrn fürchten und als Vater lieben;
- unsere Unschuld bewahren, das heißt niemandem wehtun oder Schmerz bereiten;
- Liebe üben, jedermann Gutes tun;
- Geduld üben, das Böse ertragen und nicht Böses mit Bösem vergelten.“51
Was über diese christlichen Postulate hinausgeht, bleibt freier Diskussion vorbehalten. Zu nennen ist hier ferner der Jurist Thomas Morus (1480-1535), dessen Werk De optimo rei publicae statu deque nova insula Utopia (1516), ein Nachhall des platonischen Idealstaats, die Toleranzbewegung in der Rechtsphilosophie einleitet. Morus‘ Staat beruht auf rein irdischen Interessen und Erwägungen, er ist unabhängig von kirchlicher Gewalt und widersetzt sich ihrem Eingriff. Jedem Bürger bleibt die Freiheit des Glaubens überlassen. Der Staat, dessen religiöse und konfessionelle Indifferenz Morus fordert, hat die Rechtsstellung seiner Bürger unabhängig von ihrem Bekenntnis zu wahren. Er beschränkt sich (im Sinn des späteren Deismus) darauf, einen allgemein gehaltenen Kult des höchsten Wesens einzuführen. 52
In Frankreich setzt sich der Staatsrechtslehrer Jean Bodin (1530-1597) für diese Ideen ein. Wie er in seinem (erst 1857 gedruckten) Colloquium heptaplomeres die Wortführer der verschiedensten Glaubenslehren dazu bringt, sich über die Kernpunkte einer gemeinsamen Gottesverehrung zu verständigen, so plädiert auch seine politische Philosophie für die konfessionelle Neutralität des Staates und das gleiche Recht aller Religionen. Letztere beruhen auf einer einzigen, natürlichen Religion. Ihr Wesen besteht nach Bodin in der Idee der Einheit Gottes, im moralischen Bewusstsein sowie im Glauben an Freiheit, Unsterblichkeit und Vergeltung im Jenseits.53
Bei den zum Deismus überleitenden Autoren der Renaissance stößt man häufig auf die Tendenz, biblische Texte daraufhin zu befragen, ob sie rational erkennbare „Grundwahrheiten“ enthalten, die zugleich solche der natürlichen Religion sind, oder aber dunkle, entbehrlich erscheinende „Zusätze“54 positiv-religiöser Art. Nun sind aber solche Anfänge zu historischer Bibelkritik der reformatorischen Theologie keineswegs fremd. Ein Fachmann wie Gestrich kann zeigen, dass der Deismus mehr ist als ein Produkt der von der Reformation ausgelösten religionspolitischen Konflikte. Vielmehr sind „unmittelbare Auswirkungen“ des Ereignisses selbst „in deistische Fragestellungen eingegangen“. Gestrich erinnert an die Wichtigkeit der seit der zweiten Hälfte des sechzehnten Jahrhunderts im Protestantismus „mit immer größerer Subtilität vollzogene(n) Unterscheidung derjenigen Glaubensartikel, die als fundamental (heilsnotwendig) betrachtet wurden, von den nicht-fundamentalen“ 55.
Als der erste bedeutende Vertreter einer streng historischen Bibelkritik gilt Baruch Spinoza (1632-1677). Sein 1665 entstandener Theologisch-politischer Traktat versammelt bereits jene Motive, die sich im englischen Deismus allgemein durchsetzen werden. Die „wahre Methode der Schrifterklärung“, betont Spinoza, erfordert lediglich das „natürliche Licht“56. Sie stimmt völlig überein mit der „Methode der Naturerklärung“; denn wie diese „darin besteht, eine Naturgeschichte zusammenzustellen, aus der man dann als aus sicheren Daten die Definitionen der Naturdinge ableitet, ebenso ist es zur Schrifterklärung nötig, eine getreue Geschichte der Schrift auszuarbeiten, um daraus als aus den sicheren Daten und Prinzipien den Sinn der Verfasser der Schrift in richtiger Folgerung abzuleiten. Auf diese Weise wird jeder (wenn er nur keine anderen Prinzipien und Daten zur Erklärung der Schrift und zur Darlegung ihres Inhalts zuläßt als ausschließlich solche, die aus der Schrift selbst und aus ihrer Geschichte entnommen sind) ohne die Gefahr eines Irrtums immer fortschreiten und das, was unsere Fassungskraft übersteigt, gerade so sicher besprechen können wie das, was wir durch das natürliche Licht erkennen.“57
Der letztgenannte Punkt ist für Spinoza besonders wichtig. Auch jene in der Bibel anzutreffenden Berichte, die aus den Prinzipien des natürlichen Lichts nicht ableitbar sind, verbleiben innerhalb der Reichweite vernünftigen Nachdenkens. Die Bibel besteht größtenteils aus Geschichten, die Wunder enthalten, das heißt Erzählungen von außergewöhnlichen Naturereignissen. Diese Geschichten aber, betont Spinoza, sind „den Anschauungen und Urteilen der Geschichtsschreiber angepaßt ..., die sie beschrieben haben“58. Dasselbe gilt hinsichtlich der Propheten von den Offenbarungen. Wollen wir die oft dunklen Texte gerecht einschätzen, so müssen wir nicht nur ihre Sprachgestalt und historische Herkunft sorgfältig beachten, sondern auch das Leben, die Sitten und Interessen ihrer Autoren. Bei der Lektüre der Bibel ist Vorsicht angebracht, „um nicht den Sinn der Propheten und Geschichtsschreiber mit dem Sinn des Heiligen Geistes und mit der Wahrheit des Inhalts zu verwechseln“ 59.
Was die wenigen „rein spekulativen Lehren“60 der Bibel betrifft, so reduzieren sie sich Spinoza zufolge auf die Existenz eines moralischen, Lohn und Strafe verhängenden Gottes, der alles geschaffen hat und mit höchster Weisheit lenkt und erhält. Dies begründet die Bibel „bloß durch die Erfahrung, durch die Geschichten, die sie erzählt“; sie liefert keine Definitionen, sondern passt sich sprachlich der „Fassungskraft des gewöhnlichen Volkes“61 an. Behutsame Interpretation mag biblischen Geschichten pädagogischen, erbaulichen, auch allegorischen Wert zuerkennen. Für Spinoza steht jedoch fest, dass ihre Kenntnis und der Glaube an sie nur für jene notwendig ist, deren Geist die Dinge nicht klar und deutlich zu erfassen vermag. Dass jene Geschichten geeignet sind, das Volk zu „Gehorsam und Demut“ 62 anzuhalten, räumt Spinoza ein. Aus seiner Sicht besteht ihr einziger Vorzug gegenüber profanen Erzählungen in den „heilsamen Anschauungen, die sie vermitteln“63.
Andererseits hält Spinoza den Wortlaut der Geschichten und die ihnen innewohnende Lehre scharf auseinander. Wer letztere missachtet und sein Leben nicht bessert, dem wird auch die Lektüre der biblischen Geschichten und der Glaube an sie nicht forthelfen. Wer jedoch, umgekehrt, „sie gar nicht kennt und trotzdem ... den wahren Lebenswandel hat, der ist unbedingt glückselig und hat den Geist Christi in sich“64. Spinoza ist auch darin ein Geistesverwandter zumindest der christlichen Deisten, dass er der Bibel nicht von vornherein polemisch, sondern mit einer gewissen Liberalität gegenübersteht. Er findet nichts in ihr, was „nicht mit der Vernunft im Einklang wäre oder ... ihr widerstritte“; die Propheten lehren leicht verständliche Dinge und stützen sich dabei auf Gründe, die ihnen am ehesten geeignet erscheinen, „den Sinn der Menge zur Verehrung Gottes zu bewegen“65. Spinoza ist davon überzeugt, dass die Schrift die Vernunft schon deshalb „unangetastet“ lässt, weil sie „nichts mit der Philosophie gemein hat“: beide stehen „auf eigenen Füßen“ 66.
Von hier aus gelangt Spinoza zur Selbstverständigung über die Kriterien einer wissenschaftlichen Bibelexegese und -kritik. Seine bereits erwähnte „Hauptregel“ 67 besagt, dass unser gesamtes Wissen von der Bibel „allein ihr selbst und nicht dem, was wir durch das natürliche Licht wissen, zu entnehmen ist“68. Auch „Dunkles und Zweideutiges“, auf das wir stoßen, ist nach der „allgemeinen Lehre der Schrift“, die letztlich auf Glückseligkeit und Seelenruhe abzielt, „zu erklären und zu bestimmen“ 69.
Das friedlich-schiedliche Verhältnis von Theologie und Philosophie darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass Spinozas Bibelwissenschaft letztlich dem lumen naturale das höhere Recht zuspricht. Seine Vorbehalte sind grundsätzlicher Art; sie beziehen sich auf „das Allgemeinste“, auf dasjenige, „was Basis ... der ganzen Schrift ist und ... was in ihr als ewige und allen Sterblichen höchst heilsame Lehre ... empfohlen wird“70: die Rede von Gott. Sie ist (unbeschadet ihres moralischen Zwecks und Nutzens) alles andere als eindeutig und verbindlich: „Was Gott ist und auf welche Weise er alles sieht und für alles sorgt, ... lehrt die Schrift nicht ausdrücklich und als ewige Wahrheit; vielmehr waren die Propheten darüber ... keineswegs einer Meinung. Darum läßt sich in derartigen Fragen nichts als Lehre des Heiligen Geistes aufstellen, auch wenn man sie mittels des natürlichen Lichts sehr wohl entscheiden kann.“71
Indem Spinoza mit unbeirrbarer Konsequenz den deus philosophorum dem Gott der Bibel entgegensetzt, vollzieht er einen Wandel von europäischer Tragweite. Gerade als Außenseiter, der sich mühsam den Weg in die geistige Welt seines Jahrhunderts bahnt, 57 stößt er, worauf Hirschs Geschichte der neuern evangelischen Theologie nachdrücklich hinweist, auf einen Tatbestand, der den Anderen entgeht: „daß der Begriff der christlichen Philosophen und Theologen von Gott als dem Weltschöpfer und -regierer“ nicht einfach identifiziert werden darf „mit dem metaphysischen Begriff eines absolut unendlichen, vollkommenen, ewig und notwendig existierenden Wesens“72. Spinozas welthafte, selbstgenügsame Substanz ist schlechterdings unvereinbar mit der Idee eines Schöpfers als eines „nach Plan und Zweck aus freiem Entschluß die Welt ins Dasein rufenden Verstandes und Willens“73. Über diese traditionelle Vorstellung, die einen personalen, geistigen und transzendenten Gott voraussetzt, ist die neue Wissenschaft, als deren Adept Spinoza sich betrachtet, hinweggegangen. Seine Gott-Natur, die menschlichen Wertungen indifferent gegenübersteht, ist nichts als der „ewig notwendige Grund des Weltalls selbst“74.
Der pantheistische Rationalismus erblickt in der Vollkommenheit des Intellekts das höchste, uns Menschen erreichbare Gut. Da aber alle zweifelsfreie Erkenntnis allein von Gott abhängt, weil ohne ihn „nichts sein kann noch begriffen wird“, und man, wie Spinoza mit Descartes (1596-1650) sagt, „an allem zweifeln kann, solange man von Gott keine klare und deutliche Idee hat, so hängt ... unser höchstes Gut ... allein von der Erkenntnis Gottes ab“75, das heißt von der Erkenntnis der Natur, die den „Begriff Gottes“76 in jedem ihrer Dinge ausdrückt. Je mehr wir nun fortschreiten in der Erkenntnis der objektiven Welt, desto vollkommener erkennen wir das Wesen Gottes, der Ursache aller Dinge. Eben darin besteht unser höchstes Gut. Spinoza identifiziert es mit dem Glück der Einsicht, dem amor intellectualis Dei. Ist aber die Liebe zu Gott das höchste Ziel menschlichen Strebens, das auf Glückseligkeit aus ist, so befolgt nach Spinoza nur der Mensch das „göttliche Gesetz, der Gott zu lieben trachtet, nicht aus Furcht vor Strafe noch aus Liebe zu anderen Dingen wie Vergnügungen, Ruhm usw., sondern allein deshalb, weil er ... weiß, daß die Erkenntnis und Liebe Gottes das höchste Gut ist“77.
Hier nun trennt Spinoza sich definitiv von der Theologie. Er entmythologisiert das mosaische Gesetz, indem er es herauslöst aus seiner Verflochtenheit in biblische Geschichte und es neu interpretiert als natürliches Sittengesetz. Seine wichtigsten Merkmale beschreibt Spinoza näher so:
- Es ist allgemeingültig, d.h. allen Menschen gemeinsam, denn wir haben es ja aus der allgemeinen Menschennatur abgeleitet.
- Es fordert nicht den Glauben an Geschichten, von welcher Art sie auch seien; denn da dieses natürliche göttliche
Gesetz aus der alleinigen Betrachtung der menschlichen Natur zu verstehen ist, so können wir es sicher gerade so gut in Adam begreifen wie in irgendeinem anderen, gerade so gut in einem Menschen, der unter Menschen lebt, wie in einem Menschen, der ein Einsiedlerleben führt. Auch kann der Glaube an Geschichten ... uns ... nicht die Erkenntnis Gottes und folglich auch nicht die Liebe Gottes geben.
Denn die Liebe Gottes geht aus seiner Erkenntnis hervor, seine Erkenntnis aber ist aus an sich gewissen und bekannten Gemeinbegriffen zu schöpfen; gar nicht zu denken, daß der Glaube an Geschichten ein notwendiges Erfordernis sein sollte, um zu unserem höchsten Gut zu gelangen.“78 Hierin liegt keimhaft die den späteren Deismus kennzeichnende Dichotomie zwischen zeitlosen, der menschlichen Natur entnommenen Moralprinzipien hier und einer übernatürlichen, auf die Bedeutsamkeit bestimmter historischer Ereignisse sich berufenden Offenbarung dort. Wenn Spinoza den „Glauben an Geschichten“ scharf ablehnt, so deshalb, weil er, orientiert an der ewigen, geometrisch verbürgten Ordnung der Dinge, die allem Mythisch-Narrativen anhaftende Ungewissheit scheut. Spinozas Theologisch-Politischer Traktat ist ein richtungweisendes Dokument der frühen Aufklärung. Das Jugendwerk trägt den Stempel zeitgeschichtlicher Umstände. Der Autor fordert Toleranz. Er tritt dafür ein, „daß jedem die Freiheit des Urteils und die Möglichkeit, die Grundlagen seines Glaubens nach seinem Sinne auszulegen, gelassen werden muß und daß der Glaube eines jeden, ob er fromm oder gottlos, einzig nach seinen Werken zu beurteilen ist“79.
In Erörterungen über den Wert von Religion gebührt der Frage nach ihrem moralischen Ertrag unbedingter Vorrang. So muss auch die „Göttlichkeit der Schrift“ insgesamt damit begründet werden, „daß sie die wahre Tugend lehrt“80.
Einzelne Stellen dagegen, „die bloß die Spekulation betreffen“81 und sich nur schwer interpretieren lassen, sollten jene, die „den Sinn der Schrift in bezug auf die Dinge, die zum Heile führen“82, erfasst haben, nicht weiter stören; sie besitzen, so Spinoza mit feiner Ironie, „mehr den Wert der Seltsamkeit als der Nützlichkeit“83.
Quellenangaben
- 42 Ernst Bloch, Das Prinzip Hoffnung, Frankfurt am Main 1959, S. 575.
- 43 Zitiert nach: Gustav Mensching, Die Weltreligionen, Wiesbaden 1981, S. 21.
- 44 Lucius Annaeus Seneca, Briefe an Lucilius, Brief 117, § 5-7, in: Philosophische Schriften IV, übers. von Otto Apelt, Hamburg 1993, S. 293.
- 45 Seneca, Von der göttlichen Vorsehung, in: Philosophische Schriften I, l.c., S. 3.
- 46 Ibid.
- 47 Ernst Bloch, Zwischenwelten in der Philosophiegeschichte, Frankfurt am Main 1977, S. 109.
- 48 Günter Gawlick, Artikel „Deismus“, in: Lexikon der Aufklärung, hrsg. von Werner Schneiders, München 1995, cf. S. 81.
- 49 Dilthey, l.c., S. 74 (Hervorhebungen von Dilthey).
- 50 Zitiert nach: Gustav Mensching, Toleranz und Wahrheit in der Religion, Heidelberg 1955, S. 83.
- 51 Friedrich Heer (Hrsg.), Erasmus von Rotterdam, Frankfurt am Main 1962, S. 35.
- 52 Cf. hierzu Windelband, Die Geschichte der neueren Philosophie, Band I, Leipzig 41907, S. 36f.
- 53 Cf. ibid., S. 37.
- 54 Cf. zu dieser für das religionsphilosophische Denken der Renaissance wichtigen Unterscheidung von „Grundwahrheiten“ und „Zusätzen“: Mensching, Toleranz und Wahrheit in der Religion, l.c., S. 82f.
- 55 Christof Gestrich, Artikel „Deismus“, in: TRE, Band VIII, Berlin/ New York 1981, S. 395 (Hervorhebungen von Gestrich).
- 56 Karl-Heinz Michel (Hrsg.), Anfänge der Bibelkritik. Quellentexte aus Orthodoxie und Aufklärung, Wuppertal 1985, S. 46.
- 57 Ibid., S. 43.
- 58 Ibid., S. 43.
- 59 Ibid., S. 45.
- 60 Ibid., S. 40.
- 61 Ibid.
- 62 Ibid., S. 41.
- 63 Ibid.
- 64 Ibid.
- 65 Ibid., S. 37.
- 66 Ibid.
- 67 Ibid., S. 43.
- 68 Ibid., S. 38.
- 69 Ibid., S. 45.
- 70 Ibid., S. 44.
- 71 Ibid. – Cf. hierzu auch S. 45, wo Spinoza die Schwierigkeiten der Schriftexegese wie folgt kennzeichnet: „Denn da die Propheten ... in spekulativen Dingen verschiedene Ansichten hatten und da die Darstellung den Vorurteilen jedes Zeitalters stark angepaßt ist, so können wir keineswegs den Sinn des einen Propheten aus klareren Stellen bei einem anderen erschließen und dadurch erklären, wenn es nicht ganz augenscheinlich ist, daß sie beide ein und dieselbe Ansicht hatten.“
- 72 Emanuel Hirsch, Geschichte der neuern evangelischen Theologie, Band I, Münster 31984, S. 179.
- 73 Ibid.
- 74 Ibid., S. 180.
- 75 Michel, Anfänge der Bibelkritik, l.c., S. 39.
- 76 Ibid.
- 77 Ibid.
- 78 Ibid., S. 39f.
- 79 Ibid., S. 38.
- 80 Ibid., S. 43.
- 81 Ibid., S. 45.
- 82 Ibid.
- 83 Ibid., S. 46.